Balkan | -s - Part 28
[ Balkan | -s ]
Der Vormittag des Donnerstags wie auch des Seminars Democracy and Humanrights in Multiethnic Societies ging also, wie gestern berichtet, mehr oder weniger gut über die diversen Bühnen, das parallel zu unserem abgelaufene Panel der japanischen Kollegen - "The Balkans in the Japanese focus" - (jenes Land, dessen moderne, gelbe Busse in Bosnien schon rein optisch weitaus präsenter sind denn die schäbigen alten, denen man einen blauen Anstrich und den Hinweis auf ein EU-Aufbau-Projekt verpasste) ...... hatte den überaus witzigen Effekt, dass der Exotismus ("sie kommen von einem anderen Kontinent") quantitativ obsiegte, wir jedoch mit unserer qualifizierten Minderheit dennoch wie durchwegs eine gute Diskussion zustande brachten. Die bekannten Themen (Internet wird überschätzt, Weblogs gibt es zu viele, wie soll man selektieren, wo bleibt da die Wissenschaft, ...) sind die eine Sache, die Art und Weise zu diskutieren jedoch die erfreuliche andere.
Die Zeit- und sonstigen Pläne haben sich, wie gestern schon vermutet, etwas verschoben, der alljährlich seitens unseres Panels organisierte Trip nach Mostar oder in eine weitere Örtlichkeit der Herzegovina entfällt - und wir werden gleich nach Seminarende nach Sarajevo zurückfahren, dort übernachten (alle Adressen und Hinweise folgen es in einem irgendwann noch zu schreibenden Weblog) und uns spätestens Samstag einer ausgiebigen Tour über die Hügel/Berge rund um Sarajevo hingeben. Insofern bleibt für den Moment nur mehr der Rest des gestrigen Tages anzudeuten:
Peter Emerson führte einen Workshop samt Rollenspiel zur Frage demokratischer Wahlen und -systeme durch, mit Schwerpunkt auf jene, die insbesondere Minderheiten Möglichkeiten eröffnen, wie sie etwa in Österreich nur rudimentär vorhanden sind. Ein nettes Experiment, das einerseits sein Lieblingsthema "Electronic Voting" in den Mittelpunkt zu stellen beabsichtigt war, ungeachtet dessen eine willkommene Abwechslung bot.
Zum ersten Mal richtig entsetzlich wurde es dann am frühen Abend, als Frau Justine Pilarska, Amnesty International Poland, zuerst einen Film ("Bring Democracy and Human Rights to North Korea) über nordkoreanische Flüchtlinge bot und sich anschließend nicht entblödete, höchst zwanglos Auschwitz, Gulags, Srebrenica und nordkoreanische Camps in eins zu führen, die völlige Vergleichbarkeit diktieren zu wollen und ansonsten tränenerstickt ihre Betroffenheit kundtun zu müssen meinte. Der Film selbst jedes österreichischen Adriaurlaubers und seiner audiovisuellen Bearbeitungskünste medial gebannter Erinnerungssehnsüchte unwürdig, brachte weniger Information als jede noch so zweitklassige Fernsehdokumentation des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und mir selbst gröbere Anwürfe ein, da ich diese (auch rhetorische) Verlogenheit wie Dummheit nicht mehr aushielt und mich zu Wort meldete.
Das soll jetzt nicht weiter ausgeführt werden, erschreckend war eher das totale Beharren darauf, das wir jedwedes Denken aufgeben können und ja auch die Einwohnerzahlen von Brünn und Prag verglichen werden könne, ich wahrscheinlich das Leid der Menschen in Nord Korea nicht nachempfinden könne bzw. wolle und. Eine in vielerlei Hinsicht erschreckende Performance, die sich auch ausdrücklich als Promotion für Menschenrechtsaktivitäten verstand und dringlich an die Aufkündigung der Zahlungen... Genug davon.
(Dazu vielleicht ein andermal mehr.)
Gar nicht vergleichbar dagegen die Qualität des von Azra Hromadzic geleiteten Panels, das eigentlich Mittwoch Abends stattfinden hätte sollen und aus dessen diskussionsbedingter Verschiebung heraus dem unsrigen vormittags der mehr als erfreuliche Beitrag von Mirzet Tursunovic erwachsen war.
Azra Hromadzic begann mit einem durchwegs spannenden Bericht bzw. der Präsentation ihrer Falllstudie zu bzw. über RACOON, eine NGO, die in New York sich der aus Ex-Yugoslavien stammenden MigrantInnen annimmt. Hromadzic erinnerte in diesem Zshg. (und hier scheint das wirklich brauchbar) an Derridas doppelte Struktur des Verzeihens, das ein unbedingtes kennt (für ein verzeihen des Unverzeihbaren) und jenes, bei dem Verzeihen für das eine Verzeihen die Voraussetzung für das andere ist und somit erst Reconciliation sich zu ergeben vermag. Die Diaspora-Situation bietet dafür selbstverständlich besondere Voraussetzungen, etwa insofern, als hier ein Collective Memory die Basis bilden kann, um gemeinsame Grundlagen (wieder?) zu finden. Dabei verwandtschaftsartige Beziehungen a priori festzustellen, ist natürlich mehr als relevant. Nebojsa Petrovic nahm sich anschließend der "Social Circumstances and Ethnic Options" an, Im Zuge eines OIIP-Stipendiums hatte er eine reihe von Interviews auch in Wien vorgenommen und war insofern in der Lage, die siatuativen Empfindungen, Gefühle und Befindlichkeiten hinsichtlich Ethnie, Religion, Krieg, Minderheiten etc. vergleichend darzustellen. Um das Verständnis für "Post-War Social Societies" war es ihm gegangen, weshalb die zahlreichen Interviews mit einem durchaus profunden Verständnis der Anforderungen an oral history geführt wurden.
Mura Palasek finalisierte das allein quantitativ kleine Panel mit ihrem Vortrag "Cultural Rights within the Discussion on Global Justice". Die Frage nach der Übernahme von Werten spielte naturgemäß eine nicht unwichtige Rolle, wobei Palasek ihre Argumentation durchaus provokativ hinsichtlich eines freien Marktes der kulturellen Werte zuspitzte, dessen Voraussetzung aber auch im Falle einer offiziösen Umsetzung identifikatorische Aspekte sind.
(Letzte Vorträge, dann Sarajevo, dann über Budapest nach Wien; der nächste Blog folgt Montag.)
< previous Posting next >
<< previous Topic next >>
Senior Editor

(Weitere Informationen hier)

[Die online-Fassung meines Einleitungsbeitrags "Thesen zur Bedeutung der Medien für Erinnerungen und Kulturen in Mitteleuropa" findet sich auf Kakanien revisited (Abstract / .pdf).]


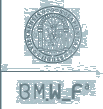
Replies